Es gehört zu den liebenswürdigen Idiosynkrasien der ökonomischen Literatur des frühen 20. Jahrhunderts, dass sie dort am hartnäckigsten spekulativ wird, wo sie glaubt, sich am festesten auf Tatsachen zu stützen. Werner Sombarts „Luxus und Kapitalismus“ ist ein solches Buch: ein gelehrtes Kuriosum, das in seiner Mischung aus kulturhistorischer Intuition, verstreuter Gelehrsamkeit und selbstbewusster Normsetzung so anachronistisch wie erstaunlich hellsichtig wirkt. Kaum ein anderer Versuch, die Genesis des Kapitalismus zu erklären, ist zugleich so weit hergeholt – und so erhellend.
Entgegen gängiger Thesen – die den Ursprung in der protestantischen Ethik, der Rationalisierung der Arbeit, der Expansion des Welthandels oder der Akkumulation abstrakter Werte verorten – beharrt Sombart darauf, dass die bürgerliche Produktionsweise allein dem Luxus entsprang: in der verfeinerten Bedürfnisstruktur eines Standes, der – getrieben von amourösen Verwicklungen, höfischer Konkurrenz und dem Reiz des Begehrenswerten – jene Nachfrage erzeugte, aus der sich kapitalistische Produktionsformen organisierten. Es wirkt, als wolle er die nüchterne Rekonstruktion des Kapitals bei Marx durch eine anthropologische Seitengeschichte unterlaufen, oder Max Webers asketischen Protestantismus durch dessen mondänes Gegenteil ersetzen: Wo Weber den kapitalistischen Geist aus der Weltablehnung des Calvinismus entspringen sieht, erkennt Sombart ihn im höfischen Exzess; wo Marx die strukturelle Logik der Warenform in den Vordergrund rückt, sieht Sombart den Anstoß im mondänen Grenzbereich zwischen Liebe, Mode und verschwenderischer Geste.
Man tut Sombart jedoch Unrecht, wenn man seine Arbeit bloß als Exzentrik abtut. Gerade aus der Perspektive einer Kritischen Theorie, die gelernt hat, die kulturellen Residuen ökonomischer Formationen ernst zu nehmen, gewinnt sein Ansatz eine eigentümliche Plausibilität. Sombarts Luxus ist, dialektisch gewendet, beides: Fortschritt und Überfluss, Motor und Maskerade, Ausdruck einer sozialen Dynamik, die den Bedürfnissen vorausgreift und sie zugleich verfremdet. Darin berührt er Adorno näher, als seine eigene Selbstgewissheit vermuten lässt: Was Sombart Beschleunigung durch Begehrenssteigerung nennt, erscheint in kritischer Wendung als das frühe Einüben jener Bedürfnisstruktur, die die Kulturindustrie später industriell reproduzieren wird.
Der vorliegende Essay will Sombarts Studie weder rehabilitieren noch entkräften. Er unternimmt vielmehr die würdigende Kritik eines Werks, das – gerade in seinen Irrtümern – Einblicke eröffnet, die die orthodoxen Erzählungen der Kapitalismusgeschichte lange verstellt haben. Sombarts Buch ist gerade wegen seiner Sonderbarkeit lesenswert. Und es verdient eine Betrachtung, die es aus dem Schatten der marxistischen Hauptlinien hervorholt, ohne seine Grenzen zu verschweigen.
Sombarts These: Luxus als unerhörter Motor des Kapitalismus
Werner Sombarts Gedanke, der Kapitalismus verdanke seine Entstehung nicht der Askese, sondern der Verschwendung, wirkt noch heute wie eine unverhoffte Verschiebung der ökonomischen Perspektive. Während die klassische politische Ökonomie den Fortschritt aus der produktiven Nützlichkeit der Arbeit erklärt und Marx die Entfaltung der kapitalistischen Produktionsweise der immanenten Logik des Wertgesetzes zuschreibt, insistiert Sombart auf einer anderen Geburtsstätte: der des Überflüssigen, Verfeinerten, Begehrten. Der Kapitalismus, so Sombarts unerschütterliche Behauptung, sei vielmehr aus Überfluss hervorgetreten als aus Not; sein Motor ist die Steigerung der Wünsche, nicht der Mangel. Luxus ist für ihn daher nicht Ornament am Rande der Geschichte, sondern deren geheime Mitte. Die höfischen Feste, die kostspieligen Geliebten, die städtischen Moden und die rauschhaften Konsumwellen erscheinen in seiner Darstellung wie eine anthropologische Vorstufe der kapitalistischen Dynamik. Worin Marx einen historischen Zwangszusammenhang erkennt – Akkumulation führt zu Ausbeutung, diese zu Expansion, jene zur Konzentration des Kapitals –, sieht Sombart eine gesteigerte Nachfrage, die neue Produktionsformen provoziert: Der Luxus, indem er Besonderes verlangt, ruft Arbeitsteilung, Spezialisierung und technische Innovation gleichsam aus dem Nichts hervor.
Die Differenz zu Marx lässt sich prägnant fassen: Bei Marx treibt das Kapital sich selbst voran, getrieben vom Zwang zur Mehrwertproduktion – M-W-M‘ als automatisches Subjekt einer Verwertungslogik, die von menschlichen Bedürfnissen abstrahiert. Bei Sombart hingegen ist es das konkrete, historisch geformte Begehren nach dem Exquisiten, das die Produktion in Bewegung setzt. Marx beginnt mit der Warenform und deren abstrakter Logik; Sombart beginnt mit dem leibhaftigen Verlangen nach Seide, Spitzen, exotischen Gewürzen. Wo Marx die Produktion als das Primäre setzt und die Konsumtion als deren Moment, kehrt Sombart das Verhältnis um: Die Nachfrage nach Luxus erzeugt erst jene Produktionsweisen, die Marx analysiert.
Das Seltsame ist das Produktive dieser These. Denn Sombart gelingt es, die Bewegungsform des kapitalistischen Geistes gerade dort sichtbar zu machen, wo die ökonomische Theorie traditionell blind bleibt: in jenen Zonen erotischer Vernetzung, gesellschaftlicher Eitelkeit und sozialer Distinktion, die die moderne Konsumgesellschaft bis heute antreiben. Im Luxus erkennt er die präformierte Logik dessen, was später als das „immer Mehr“ kapitalistischer Dynamik zum abstrakten Imperativ wird. Der Luxus artikuliert als Bedürfnis, was der Kapitalismus später als System vollzieht.
Es wäre leicht, Sombarts Konstruktion als Übertreibung abzuweisen – aber das wäre zugleich eine Verkennung ihres heuristischen Reizes. Seine These verfügt über eine eigentliche Wahrheit, die jenseits ihrer historischen Gewagtheit liegt: Der Kapitalismus beginnt dort, wo Wünsche den Rahmen des Notwendigen überschreiten und die Produktion zwingt, sich nach dem Begehrenswerten zu richten. Luxus ist in dieser Sicht die erste Schule der Überbietung, das soziale Labor der Steigerungslogik, der Vorbote jener Ökonomie des Unersättlichen, die später die Massenkultur formiert.
Dass Sombart in dieser Pointe bisweilen ins Polemische kippt – die „blödesten Augen“, die seinen Zusammenhang nicht sehen wollen –, mag zeithistorisch erklärbar sein. Aber es verdeckt nicht, dass sein Vorschlag eine epistemische Provokation bleibt: die Geburt des Kapitalismus aus dem Geist des Exzesses, nicht der Vernunft.
Sombarts historische und soziologische Perspektive: Liebe, Luxus, und die unerwarteten Triebkräfte der Moderne
Es gehört zu Sombarts Eigentümlichkeiten, dass er dort am kühnsten wird, wo das Historische ins Anthropologische umzuschlagen scheint. Die materiellen Wandlungen vom Mittelalter zur Neuzeit, die fortschreitende Urbanisierung, das Aufkommen des höfischen Lebens – all das beschreibt er mit einer Nonchalance, die die kulturhistorischen Traditionen ebenso aufruft wie sie sie verzerrt. Doch gerade in dieser Mischung aus Empirie und Imagination gewinnt seine Darstellung eine eigentümliche Schärfe: Die Geschichte des Kapitalismus erscheint als Geschichte der Bedürfnisse, und diese wiederum als Geschichte der Liebe.
Der frühe Feudalismus, so Sombart, kannte keine kapitalistische Verwertungslogik des Reichtums. Besitz war Grundbesitz, Prestige war Herkunft; Arbeit galt den Vornehmen als beschämend, Geldverdienen als Zeichen eines niederen Standes. Erst mit der allmählichen Entmoralisierung der Liebe – der Befreiung des Begehrens aus dem Bann der Sünde – treten die gesellschaftlichen Verhältnisse in ein neues Stadium ein. Der Minnesang, den Sombart, nicht ohne den Charme einer gewissen Übertreibung, die „Pubertätserotik“ einer aufbrechenden Neuzeit nennt, wird zur Ouvertüre eines Begehrens, das den Luxus erst möglich macht.
Die Mätressen- und Kurtisanenkultur der Renaissancehöfe bildet in dieser Sicht vielmehr einen strukturellen Motor der sozialen Differenzierung als bloß ein sittengeschichtliches Kuriosum. Denn die Geliebte – ob königliche Favoritin oder städtische Kurtisane – wird bei Sombart zur Figur einer neuen Ökonomie: Ihr Anspruch auf Pracht, Kleidungsstücke, Schmuck, exotische Waren zwingt den Mann zur Erwerbstätigkeit, zur Suche nach Reichtum, zu jener produktiven Anstrengung, die das höfische Leben längst nicht mehr garantieren kann. Die Liebe, die sich hier darbietet, ist zugleich privat und öffentlich, intim und ökonomisch: Sie erzeugt den Luxus und legitimiert ihn zugleich.
Sombart belegt diese These mit einer Fülle historischer Beispiele, die – so spekulativ ihre Verknüpfung bisweilen wirkt – doch eine gewisse anekdotische Überzeugungskraft besitzen. Da ist Madame de Pompadour, die Mätresse Ludwigs XV., deren Ausgaben für Kleider, Schmuck und Parfüms ganze Manufakturen in Bewegung setzten; da sind die venezianischen Kurtisanen, deren Nachfrage nach kostbaren Stoffen und orientalischen Luxusgütern den Fernhandel ankurbelte; da ist schließlich die sächsische Mätressenwirtschaft am Dresdner Hof, wo die Geliebten Augusts des Starken – so Sombart – mehr für die ökonomische Entwicklung bewirkten als sämtliche merkantilistischen Erlasse. Die Frau als Konsumentin avant la lettre, als Agent einer Nachfrage, die das Angebot erst hervorbringt: Das ist Sombarts kühner, durchaus problematischer, aber nicht ganz unplausibler Gedanke.
Auch die Ehe, die in adeligen Kreisen über Jahrhunderte kaum mehr war als eine institutionalisierte Allianz zweier Häuser, wird durch diese Verschiebung sekundär. Montaignes Diktum, Lieben und sich binden seien unvereinbar, zitiert Sombart mit sichtlicher Genugtuung: Eine Liebe, die nicht im gesellschaftlichen Vertrag aufgeht, verlangt nach Ausdrucksformen jenseits der nüchternen Haushaltskalkulation. Luxus, so gedeutet, ist das erste Ventil einer Gefühlskultur, die die Ökonomie anstachelt, neue Wege zu finden.
Es ist nicht allein der Adel, der hier zum Protagonisten wird. Sobald der Luxus die fürstlichen Höfe verlässt und in die Städte dringt, sobald die „Knallprotze“, „Pfeffersäcke“ und bürgerlichen Emporkömmlinge ihre eigenen Nebenbeziehungen pflegen, multipliziert sich die Nachfrage nach Luxus ins Unermessliche. In dieser sozialen Verbreiterung erkennt Sombart die Vorstufe jenes Massenkonsums, der später die kapitalistische Moderne prägen wird: Der Luxus wandelt sich von einer exklusiven Geste zu einer sozialen Logik. Was zunächst Distinktionsmittel weniger war, wird allmählich zum Strebungsziel vieler – und fördert damit jene Massenproduktion, die den Luxus paradoxerweise demokratisiert und zugleich entwertet.
Und schließlich: der Übergang vom personalen zum versachlichten Luxus. Während der höfische Prunk an Personen gebunden war, werden die Bedürfnisse der modernen Gesellschaft zunehmend technisch, industriell, reproduzierbar. Der Luxus verliert seine Aura, ohne seine Funktion einzubüßen. Er wird Produkt, Ware, Bedürfnisform – und damit kapitalistisch organisierbar. Die Plantagenwirtschaft, die Feinhandwerke, die Kolonialimporte erscheinen Sombart als Folge dieser Transformation: Die Nachfrage nach dem Besonderen erzwingt das Universale der Produktion. Der Tee aus Ceylon, der Zucker aus der Karibik, die Baumwolle aus Indien – all das sind, in Sombarts Lesart, Produkte einer Luxusnachfrage, die sich globalisiert und industrialisiert.
So entsteht ein Geschichtsbild, das man trotz seiner spekulativen Züge nicht zu schnell beiseiteschieben sollte. Denn es markiert eine Wahrheit über die kapitalistische Moderne: Die Ökonomie geht vielmehr aus gesteigerten Formen des Begehrens hervor als allein aus Zweckmäßigkeit; umgekehrt richtet sich die Produktion nach den Verwicklungen des Sozialen und folgt nicht einfach der Logik der Produktion. Was Sombart sichtbar macht – wenn auch in verzerrter Form –, ist die libidinöse Ökonomie des Kapitalismus, jene Verschränkung von Begehren und Bereicherung, die Marx zwar im Begriff des Fetischismus andeutet, aber nicht systematisch entfaltet.
Kritische Einordnung aus Sicht der Kritischen Theorie: Die Dialektik des Luxus – Sombarts Glanz und sein blinder Fleck
Die eigentliche Herausforderung, Sombarts Theorie ernst zu nehmen, beginnt dort, wo sie unweigerlich ins Sonderbare umschlägt. Denn seine Behauptung – der Kapitalismus sei das Kind des Luxus, nicht der Not – ist derart entgegen jeder ökonomischen Orthodoxie, dass sie beinahe unfreiwillig zu jener Wahrheit drängt, die die Kritische Theorie stets verfolgt: dass die gesellschaftliche Totalität nicht aus ihren offiziellen Begründungen verstanden werden kann. Wo die Wissenschaft sich auf Normen der Rationalität zurückzieht, öffnet die Übertreibung, das Irrationale, manchmal den Blick für das Verdrängte.
In diesem Sinne hat Sombart, ohne es zu beabsichtigen, einen Gedanken freigelegt, der die marxistische Analyse ergänzt, wo sie strukturell nicht zugreift: die Einsicht, dass der Kapitalismus sowohl aus einem System der Produktion als auch der Verführung besteht; dass die Ökonomie eine libidinöse Struktur besitzt, die die abstrakte Arbeit in Beziehung setzt zu Trieb, Begehren, Anerkennung. Was bei Marx als Fetischismus auftritt – die Verzauberung der Warenform –, gewinnt bei Sombart eine historische Vorgeschichte: Die Fetischisierung erstreckt sich über die Ware hinaus auf die gesellschaftliche Praxis des Begehrens, die sie hervorbringt.
Luxus als frühe Form der Kulturindustrie
Adorno hätte vermutlich an Sombarts These gereizt, dass der Luxus eine prototypische Form dessen ist, was er später „Kulturindustrie“ nennt. Denn im Luxus erscheint die Ware vielmehr als Versprechen von Distinktion, Einzigkeit, Status als bloßer Gegenstand des Gebrauchswerts. Die Kurtisane, die das kostspielige Kleid verlangt; der Höfling, der sich durch neuartige Stoffe über andere erhebt; der Bürger, der durch exotische Importe seine Stellung mimisch steigert – all dies sind frühe Szenen jener Ökonomie des Scheins, in der das Bedürfnis selbst schon Ergebnis der Machtverhältnisse ist.
Er erkennt, dass der Luxus Jenseits einer bloßen Folge gesellschaftlicher Ungleichheit deren wirkmächtiger Agent ist: dass er Wünsche schafft, Subjekte formt, Vergleiche erzwingt. Luxus ist nicht der bloße Überschuss einer Gesellschaft, er fungiert vielmehr als deren pädagogische Einrichtung zur Erzeugung von Begehrensmustern. Darin liegt – dialektisch gewendet – ein Fortschritt: Das Bedürfnis wird historisch, die Lust sozial, die Ökonomie psychologisch. Und zugleich ein Verhängnis: Wo das Begehren sich ökonomisch vergegenständlicht, verliert die Subjektivität ihr Widerstandspotential.
Der Luxus fungiert als Dispositiv der Bedürfnisproduktion – und darin ähnelt er strukturell jener Kulturindustrie, die Adorno und Horkheimer als Herrschaftstechnik analysierten. Was im 17. Jahrhundert die höfische Mode leistet, vollbringt im 20. Jahrhundert die Werbeindustrie: die systematische Erzeugung von Begehrensstrukturen, die das Subjekt an die Warenform bindet. Sombarts Luxus ist gewissermaßen die Urszene dieser Unterwerfung – der Moment, in dem das Begehren kapitalistisch organisierbar wird.
Die Grenze des Sombartschen Blicks
Doch gerade diese Stärke ist Sombarts größter Schwachpunkt. Er bleibt der Faszination des Gegenstandes verhaftet und übernimmt zu oft die Logik des Luxus, anstatt sie kritisch zu durchdringen. Seine Bewunderung für das Exquisite verschleiert die Gewalt, die im Produktionsprozess steckt: die koloniale Plantage, die Ausbeutung fernster Arbeitskräfte, die Brutalität des Herstellungsprozesses, der die Voraussetzung des europäischen Begehrens bildet. Adorno hätte an dieser Stelle den Schleier gelüftet: Der Luxus, der sich in seidenen Stoffen und kostbaren Gewürzen darbietet, ist ein Depot unverarbeiteter gesellschaftlicher Schuld. In Sombarts Darstellung bleibt diese Dimension merkwürdig unsichtbar.
Wenn Sombart von Zucker, Tee und Baumwolle spricht, schweigt er über die Sklavenarbeit auf den karibischen Plantagen, über die gewaltsame Unterwerfung indischer Textilarbeiter, über die koloniale Ausbeutung, die den europäischen Luxus erst ermöglicht. Der Glanz der Oberfläche ist die Form, in der die Gewalt ihrer Produktion unsichtbar wird und Sombart, gefangen in seiner kulturhistorischen Perspektive, reproduziert diese Verdeckung. Was er als Triumph des Begehrens feiert, ist in Wahrheit ein Triumph der Herrschaft.
Auch anthropologisch verkürzt sich seine Perspektive. Der Mann, der durch die Geliebte zum Kapitalisten wird, die Liebe als ökonomische Anstiftung: Das ist originell, aber zugleich ideologisch. Es verlegt eine strukturelle Bewegung – die Entstehung der kapitalistischen Produktionsweise – in ein personalisiertes Drama erotischer Beziehungen. Sombarts Theorie ist durchzogen von einer Geschlechtermythologie, die das Soziale auf die Psychologie des Mannes reduziert und die ökonomische Objektivität ins Theater des Begehrens verschiebt. Was er als anthropologische Konstante ausgibt, ist in Wahrheit eine kulturelle Projektion – die Frau als Triebkraft männlicher Produktivität, eine Phantasie, die mehr über Sombarts eigene Epoche verrät als über die Geschichte des Kapitalismus.
Die Dialektik des Luxus: Fortschritt und Regression
Auf einer höheren Ebene jedoch hat Sombart ein dialektisches Motiv getroffen, das für die Kritische Theorie zentral ist: dass gesellschaftlicher Fortschritt stets regressiv ist. Der Luxus, der die Arbeitsteilung fördert, spezialisierte Produktion hervorbringt und kapitalistische Innovationen anstößt, erzeugt zugleich eine Welt der Entfremdung, der Abhängigkeiten, der sozialen Nötigungen. Seine glänzende Oberfläche verdeckt die Verwüstung, die er hinterlässt. Der Kapitalismus gewinnt Gestalt im Ornament, aber er verleiht sich Dauer im Zwang.
Denn seine These enthält, richtig gelesen, ein Moment der Aufklärung über den Kapitalismus: Er zeigt, dass dessen Entwicklung vielmehr aus Übersteigerung entspringt als aus Rationalität; die treibende Kraft ist allein der Exzess, nicht die Mäßigung. Was Sombart nicht ausspricht, ist die Konsequenz: dass ein System, das aus dem Überflüssigen stammt, dazu tendiert, das Notwendige zu zerstören. Die Steigerungslogik, die der Luxus inauguriert, kennt kein Maß – und führt daher unweigerlich zur Verwüstung der natürlichen und sozialen Grundlagen, auf denen sie beruht.
Sombart als Symptom und Herausforderung
Sombarts Theorie endet nicht dort, wo ihre Exzentrik offenbar wird; sie endet dort, wo ihre Wahrheit an die Grenze der eigenen Ideologie stößt. Denn eine Ökonomie, die aus dem Überflüssigen hervorgeht, bleibt unweigerlich anfällig für jene Verblendungen, die der Luxus selbst hervorbringt: die Verwechslung der gesellschaftlichen Form mit ihrem ornamentalen Ausdruck, die Überschätzung des Begehrens gegenüber der Gewalt, die es strukturiert, und die Tendenz, das Historische im Anthropologischen aufzulösen. Gerade darin wird Sombart zum Symptom einer Epoche, die die Verführungen der Moderne kennt, aber ihre Zumutungen nur unzureichend begreift. Was Sombart sichtbar macht – dass der Kapitalismus sowohl aus Arbeit als auch aus Begehren besteht; dass die politische Ökonomie ohne Psychologie blind bleibt; dass die Ware ein ästhetischer Gegenstand ist, bevor sie ein ökonomischer wird –, bleibt bedeutsam. Seine Theorie erinnert daran, dass die kapitalistische Dynamik vielmehr aus jenen hyperbolischen Formen des Wünschens verstanden werden muss als allein aus den Zwängen der Produktion, die sozialen Aufstieg, gesellschaftliche Differenz und libidinöse Investition miteinander verschränken. Darin liegt der produktive Kern seines Ansatzes: Er hebt die Heterogenität der Triebkräfte der Moderne hervor, die die marxistische Orthodoxie nur schwer integrieren konnte.
Doch zugleich zeigt sich in seinem Werk die Gefahr, die Kritische Theorie stets zu bannen suchte: dass die Analyse selbst in die Logik verfällt, die sie beschreibt. Sombart ist fasziniert vom Glanz des Luxus – und verliert gerade deshalb den Blick für die Verwüstungen, die ihn ermöglichen. Er ästhetisiert, wo er kritisieren müsste; er psychologisiert, wo gesellschaftliche Strukturen sprechen; er personalisiert, wo Objektivität geboten wäre. Sein Interesse am Exzeptionellen verstellt die Einsicht in die systematische Gewalt, die die kapitalistische Moderne trägt. So wird seine Theorie – unvermeidlich – zu einem Teil jener Ideologie, deren Ursprünge sie erklären will.
Dass Sombart in den 1930er Jahren schließlich ins Fahrwasser des Nationalsozialismus geriet – sein „Deutscher Sozialismus“ von 1934 ist ein beschämendes Dokument dieser Wendung –, erscheint aus dieser Perspektive weniger als biographischer Zufall denn als symptomatische Konsequenz. Seine Neigung, strukturelle Widersprüche in anthropologische Konstanten zu übersetzen, seine Tendenz zur Naturalisierung gesellschaftlicher Verhältnisse, seine Fixierung auf das Irrationale als historische Triebkraft – all dies birgt jene Gefahr der Mythologisierung, die der Kritischen Theorie stets verdächtig bleiben muss. Wo das Historische ins Anthropologische umschlägt, ist der Weg zur Ideologie nicht weit.
Aus einer kritischen Perspektive ist Sombart daher weniger ein Gegenentwurf zu Marx als dessen unfreiwillige Ergänzung. Er zeigt die libidinösen, erotischen, affektiven Energien, ohne die der Kapitalismus nicht denkbar ist – doch er verschweigt, dass diese Energien selbst gesellschaftlich produziert werden. Was bei ihm naturwüchsig erscheint, ist in Wahrheit historisch geformt; was er als anthropologische Konstante setzt, ist das Resultat der Vergesellschaftung. Die Dialektik des Luxus, die er intuitiv berührt, könnte nur dann begriffen werden, wenn der Glanz seiner Oberfläche zugleich als Ausdruck und als Verdeckung gesellschaftlicher Herrschaft gelesen würde.
Gerade darin liegt die Herausforderung, die von Sombart bleibt: sein Ansatz verlangt eine Kritik, die über ihn hinausgeht. Denn er öffnet eine Perspektive auf die kapitalistische Moderne, die nicht in Kategorien der Zweckrationalität aufgeht, sondern das Verhältnis von Bedürfnis und Macht, Begehren und Ökonomie, Affekt und Struktur ins Zentrum rückt. Die Aufgabe besteht darin, diese Einsicht zu retten, ohne in jene Mythen zurückzufallen, aus denen sie stammt.
Sombart liest den Kapitalismus als Produkt des Exzesses – und verkennt gerade dadurch, wie dieser Exzess sich zur Normalität verallgemeinert. Aus dem Luxus als Ausnahme wird die Steigerung als Regel. Was einst als Ornament erschien, ist heute zur Struktur geworden. In dieser Verschiebung liegt der eigentliche historische Ertrag seines Ansatzes: Er zeigt, dass der Kapitalismus nicht zufällig luxuriös ist, sondern dass der Luxus die Wahrheit seiner Form enthält – die Entgrenzung, die Überbietung, den permanenten Anspruch auf das Mehr.
Dass Sombart diese Wahrheit nur halb erfasst, macht sein Werk zwar nicht entbehrlich, wohl aber unvollendet. Es fordert eine Kritik heraus, die statt die Oberfläche gegen die Tiefe auszuspielen, vielmehr die Dialektik beider begreift. Denn der Kapitalismus ist – im letzten – weder Askese noch Exzess, sondern ihre unauflösliche Verschmelzung. Sombarts Buch enthält den Keim dieser Einsicht, auch wenn es ihn nicht zur Reife bringt.
Seine Theorie bleibt damit ein historischer Grenzfall: ein Werk zwischen Erkenntnis und Ideologie, zwischen hellsichtiger Diagnose und kulturkritischer Verblendung. Aus ihm lernen heißt, seine Wahrheit gegen seine Form zu retten. Und darin liegt vielleicht die wichtigste Aufgabe: die Ambivalenz des Überflüssigen so zu begreifen, dass das Notwendige wieder sichtbar wird.
Literatur:
Werner Sombart: Luxus und Kapitalismus, Duncker & Humblot, München und Leipzig 1913
https://kpbc.umk.pl/Content/268056/Magazyn_398_POWER_010_01.pdf
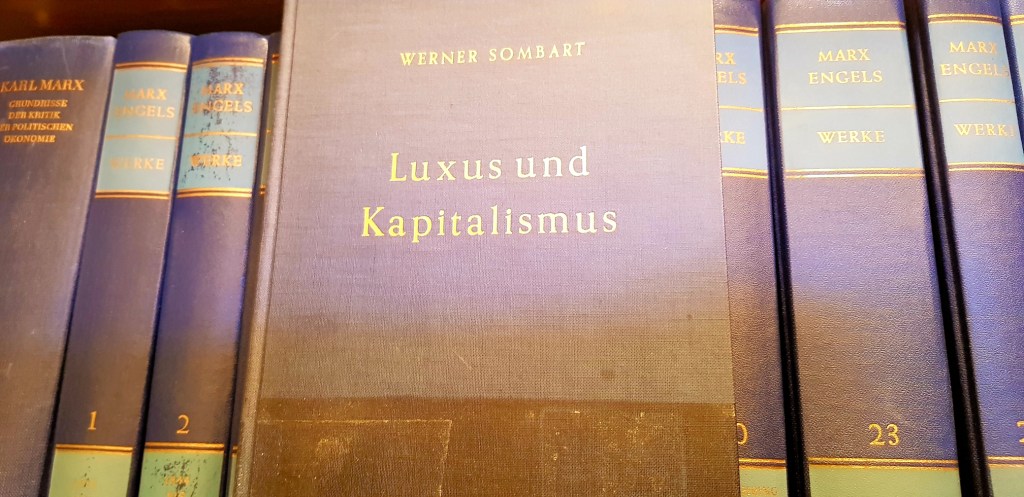
Hinterlasse einen Kommentar